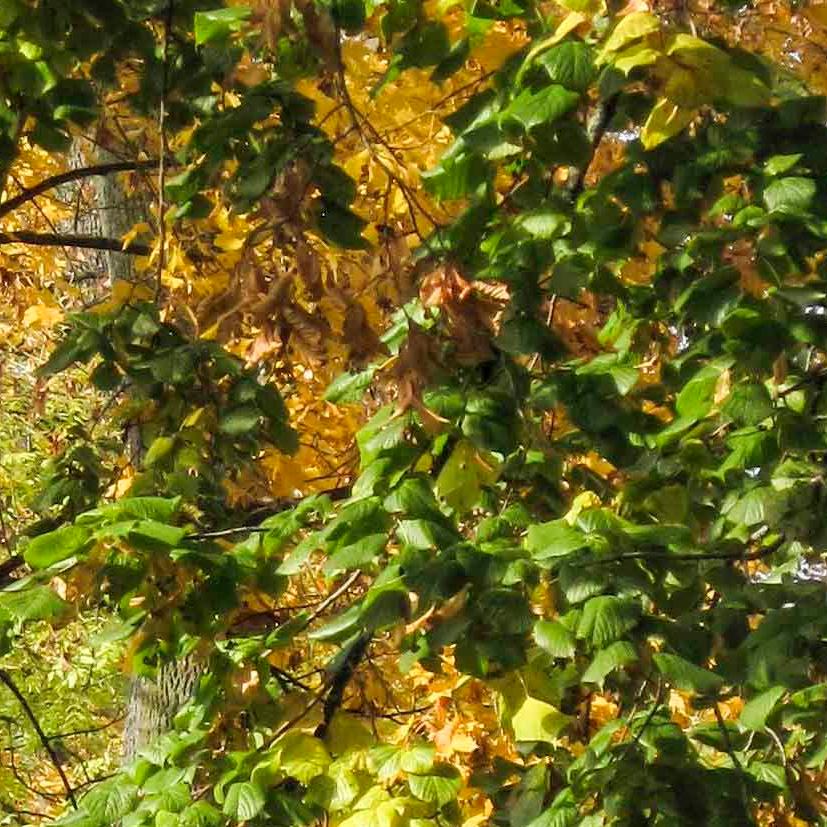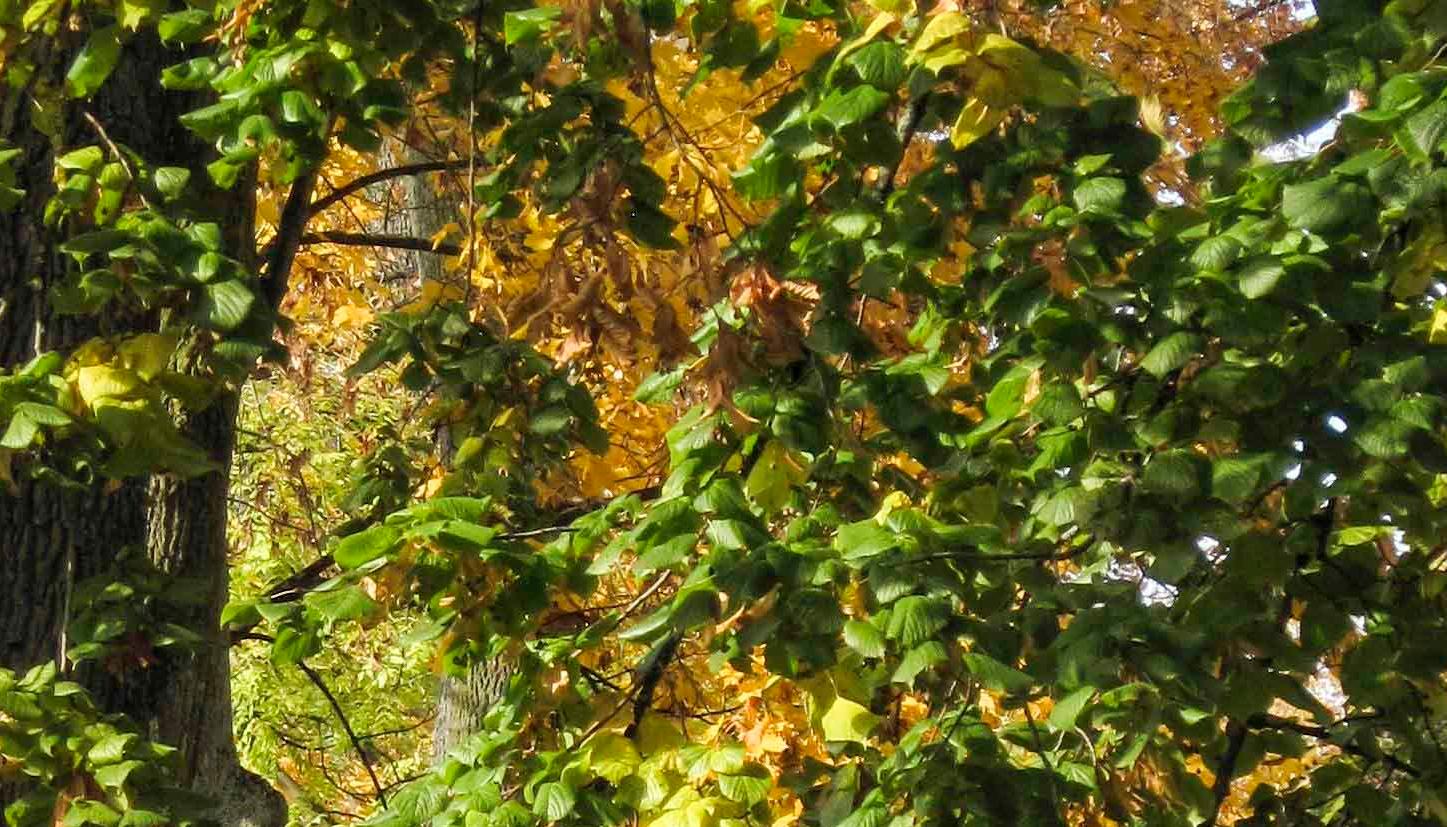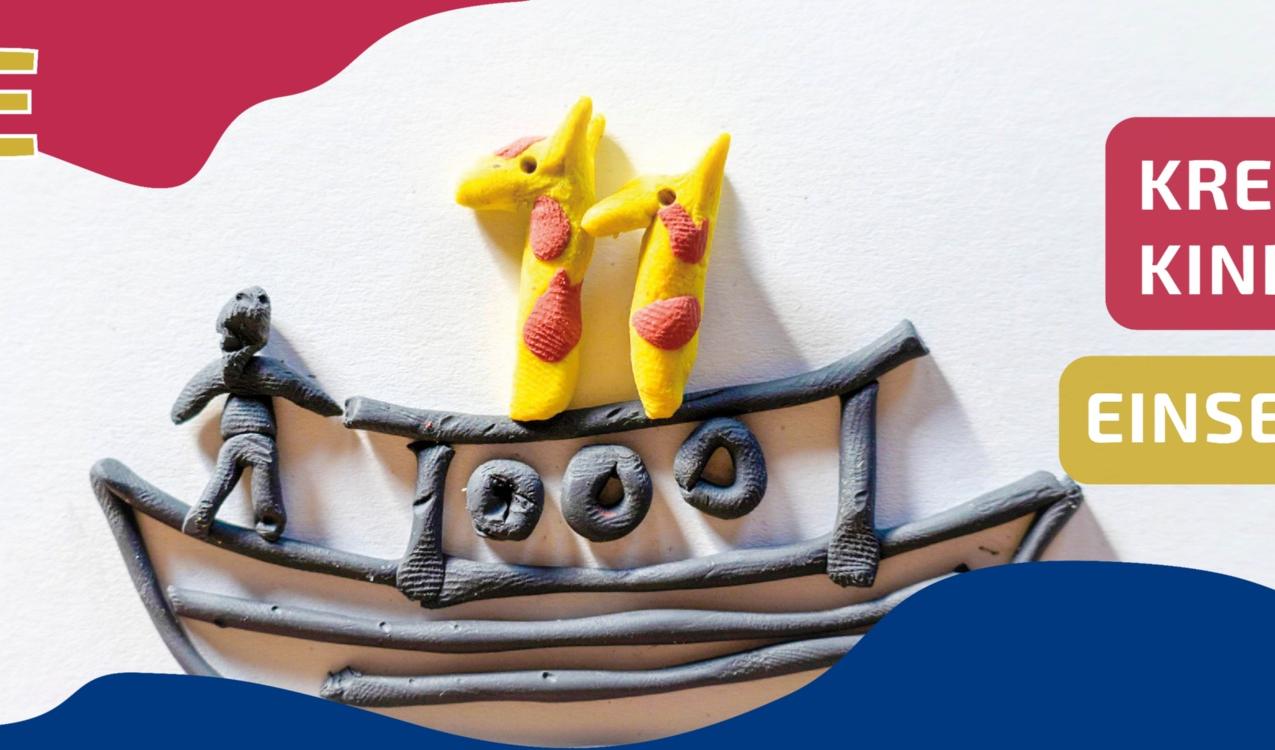Vom 13. März bis 10. Juni 2025 im Schatten der Basilika
Vom 13. März bis 10. Juni 2025 setzt die Glasarche 3 ihren Anker in Vierzehnheiligen, direkt neben der Basilika. Mit dieser beeindruckenden Kunstinstallation aus Glas und Holz wird ein Bogen gespannt von der biblischen Erzählung über Noah bis hin zum Arten- und Naturschutz unserer Tage, vom Hl. Jahr 2025 bis hin zum 10jährigen Jubiläum der Veröffentlichung der päpstlichen Enzyklika Laudato si'.
Wunderschön und zerbrechlich - so wird diese Glasarche vor der Basilik in Vierzehnheiligen stehen. Sie ist ein Symbol für die Schönheit und Fragilität der Natur. So wie die Arche Noah im Buch Genesis führt sie uns die Verantwortung für diese Welt und die Vielfalt der Geschöpfe vor Augen.
Weit gereist
Das Kunstwerk wurde vom Landschaftspflegeverband "Mittleres Elstertal e. V." initiiert und reist seit 2016 durch Deutschland. Nach Stationen u. a. vor der Dresdner Frauenkirche, dem Augsburger Dom, den Nationalparks Hainich und Eifel sowie der Kaiserpfalz Memleben macht sie nun im Frühjahr 2025 Halt an der Basilika Vierzehnheiligen. Erschaffen wurde die Arche vom Künstler Ronald Fischer in Zusammenarbeit mit den Glaskünstlern des Ateliers Männerhaut. Die haltende Holzhand wurde von Christian Schmidt und Sergyi Dyschlevyy ersonnen und gestaltet.
Das fünf Meter große gläserne Boot wird getragen von einer Hand aus Eichenholz. Diese steht für das Bedürfnis nach Schutz, auch für unseren Wunsch nach einer großen Hand, die uns vor Gefahren schützt. Zugleich scheint die Arche der hölzernen Hand scheinbar zu entgleiten, so dass die Veranwortung für ihren Erhalt auf den konkreten Betrachter übergeht. Die Botschaft ist klar: Auch wir tragen Verantwortung für den Erhalt unseres Planeten. Wir besitzen die Fähigkeit zur Bewahrung aber auch zur Zerstörung der Schöpfung.
Hoffen und Handeln
In der Glasarche spiegelt sich so in besonderer Weise die Intention wider, die Papst Franziskus in seiner Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato si' (2015) verfolgt: die Sorge um den Planeten, den wir gemeinsam mit allen Menschen und mit allen Mitgeschöpfen bewohnen. Damit stellt die Kunstinstallation auch einen hervorragenden Auftakt für das Projekt "Unsere (Um-)Welt - Hoffen und Handeln" anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Veröffentlichung der Enzyklika dar. Mit verschiedensten Veranstaltungen und Aktivitäten werden wir in der Erzdiözese Bamberg bis Juni 2026 die Anregungen des Papstes für Umwelt- und Klimaschutz aufgreifen.
Zugleich spannt die Arche den Bogen zum Heiligen Jahr 2025 und seinem Motto "Pilger der Hoffnung". Denn sie steht wie kaum ein anderes Symbol dafür, dass auch in den größten Katastrophen der Keim zu etwas Neuem liegen kann, dass Gott uns auf eine Zukunft und einen versöhnten Neuanfang hoffen lässt. Diese Hoffnung will allerdings nicht dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen, sondern ganz im Gegenteil im Vertrauen auf den göttlichen Beistand dazu aufrufen aktiv zu werden und an einer besseren, einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen und für das ganze "gemeinsame Haus" zu arbeiten.
Die Glasarche ist ein gemeinsames Projekt des Umweltreferats der Erzdiözese Bamberg, den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen sowie dem Kloster Vierzehnheiligen.
Lassen Sie bei einem Besuch in Vierzehnheiligen diese kraftvolle Symbolik im Schutz der Basilika und in ruhiger Reflexion wirken!
Die Arche steht als Symbol für Rettung und Neuanfang:
- Welche „Sintfluten“ habe ich in meinem Leben bisher erlebt?
- Was waren und was sind meine Archen in schwierigen Zeiten?
- Wie konnten und können daraus Keimzellen für etwas Neues werden?
- Wie können wir Archen (persönliche, gesellschaftliche) bauen für künftige Stürme? Was möchte ich retten?
In der Glasarche wird auch die Zerbrechlichkeit des „gemeinsamen Hauses“ aller Geschöpfe deutlich:
- Welche Verantwortung tragen wir als Menschen für die Schöpfung?
- Wo kann ich persönlich diese Verantwortung wahrnehmen oder nehme sie schon wahr?
- Wie kann ich mir das fruchtbare Beziehungsgefüge verschiedener Tier- und Pflanzenarten bewusstmachen?
- Wie kann die Arche Quell für Hoffnung und Zuversicht werden?
Impulsvortrag von Prof. Dr. Ottmar Fuchs zum Motiv der Arche
(gehalten bei der Vernissage zur Glasarche 3 am 19. März 2025):
Die Arche, eine zwiespältige Geschichte
1.Hinführung
Ach, wie wunderbar hat sich die Arche in die christliche Vorstellungswelt, der Kinder vor allem auch, eingewurzelt. In wunderschönen Darstellungen in Kinderbüchern, in Bildern der Volksfrömmigkeit (ich denke hier vor allem an die eindrucksvolle Tonplastiken aus Lateinamerika), in unzähligen Gemälden der Jahrhunderte: Die Arche ist wirklich zu einem starken Motiv geworden, inhaltlich zu einem Motiv der Rettung und der Notwendigkeit einer besseren Welt, nach der Sintflut!
Mit der gläsernen Arche, die hier installiert ist, haben wir ein weiteres Kunstwerk mit einer eigenen Bedeutungsgeschichte. Seit über zehn Jahren ist diese Arche bereits in dreifacher Ausführung auf Wanderschaft in verschiedenen Städten, Parks und auch unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen. Anfangs ist sie bereits zu einem Hoffnungs- und Widerstandssymbol für die Glasbäsereien geworden, sie ist ein Mahnmal für Unternehmer und Konzerne, ihre soziale Verantwortung für die Menschen im Bayerischen Wald nicht dem Profit zu opfern. Ein Schiff aus Glas, nicht zu übersehen und zugleich durchsichtig und zerbrechlich. Ein starkes Symbol für verschiedene Intentionen und Zusammenhänge. Und immer geht es dabei um Rettung, um Solidarität und soziale Verantwortung.
Der inhaltliche Zusammenhang, der besonders in der Aufstellung neben der Basilika von Vierzehnheiligen aufgerufen und angesprochen wird, ist das Überleben der Erde mit ihrer Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren und der Solidarität der Menschen untereinander, mit der Erinnerung an die Umweltenzyklika Laudato si von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015. So heißt der inhaltliche Raum, in dem das Glassymbol seine Wirkung entfaltet „Unsere Umwelt. Hoffen und handeln.“ Und ist mit dem Heiligen Jahr verbunden mit dem Motto, Pilger und Pilgerinnen der Hoffnung zu sein und zu werden.
Schon diese Ausstellungsgeschichte der gläsernen Arche zeigt die Flexibilität, den möglichen vielfältigen Bezug dieses Symbols an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Intentionen. Nicht viel anders „funktioniert“ die Arche auch in den einschlägigen biblischen Texten.
- Die Arche in der Bibel
In der Bibel ist die Arche eigentlich kein Schiff, sondern zunächst eher eine Schachtel. In der Hebräischen Schrift kommt das gleiche Wort nochmal in der Geschichte des kleinen Moses vor, der in einem Schilfkorb vor den Wassern des Nils und den Feinden bewahrt wird.
Die Vorschrift, die Arche nach genauen Maßen zu bauen, erinnert an die Maße des Tempels. Der Tempel, der zentrale Ort der Rettung, wird mit diesem Symbolwert auf die Arche übertragen. Nun ist die Arche Ort der Rettung. Zugleich wird mit der Arche nicht nur die Welt, sondern auch der Tempel und der Ort Gottes gerettet. Aber für wen?
- Erschreckendes Gottesbild
Theologisch, also vom Gottesbild in dieser Geschichte her zeigen sich vom Anfang bis zum Schluss zwei Vorstellungen von Gott, die gegensätzlicher nicht sein können. Und die Geschichte erzählt den unvermittelten Übergang von einem zum anderen Gottesbild.
Das erste Gottesbild ist erschreckend: Es ist die Rettung einer kleinen heilen Miniwelt, um die herum alles andere zugrunde geht. Gott hat genug mit dieser Menschheit, sie ist böse und gottlos, bis auf die Ausnahme des Noah, und so reut es ihn, dass er die Menschheit geschaffen hat und bestraft sie mit ihrer Vernichtung. Ein Gottesbild aus den Urkammern schlechtester Religion. Gott reagiert mit Strafe und will die Menschen durch den schlimmsten Zwang, nämlich vernichtet zu werden, neu an die Kandare nehmen. Die Religionsgeschichte, auch die Kirchengeschichte, ist voll mit diesen zerstörerischen Strategien: Menschen mit Strafängsten bei der Stange zu halten. Hier steht die Arche für das, was wir lieber nicht mit ihr verbinden wollen: mit jener Rampe, an der zwischen lebenswerten und lebensunwerten Leben entschieden wird und wo das letztere vernichtet wird. Mit der Unterstellung, sie hätten die Strafe verdient.
Übrig bleibt die abgeschlossene Gruppe der Auserwählten exklusiv, die anderen, nicht dazugehörigen ausschließend, und wie sich später zeigt, dann doch nicht so unschuldig. Von Gott her wird hier die Lizenz ausgegeben, die Sündigen und Ungläubigen und die fast die gesamte Tierwelt von den Lebensmöglichkeiten auszuschließen und der Vernichtung zu übergeben. Nelly Sachs hat diese Schicksalsabhängigkeit der Tiere von den Menschen folgendermaßen ins poetische Wort gebracht:
O ihr Tiere
Euer Schicksal dreht sich wie der Sekundenzeiger
mit kleinen Schritten
in der Menschheit unerlösten Stunde.[1]
- Das ganz andere Gottesbild
Dann aber das dazu völlig gegensätzliche Gottesbild: die Rücknahme des Vernichtungsbeschlusses durch Gott selbst. Als reute es ihn. So steht in Gen 9,11 „Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen: nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben.“ Nie wieder also will Gott mit Vernichtung bestrafen! Er schließt einen Bund, in dem er sich nur noch als guter Gott, als unendlich liebender Gott erfahren lässt. Auch bezüglich sündiger und nichtglaubender Menschen. Bei Jesus wird es heißen, dass Gott alles Leben wachsen lässt, im Bild, dass Unkraut und Kraut bis zur Ernte nicht um ihre Lebensmöglichkeiten gebracht werden. (vgl. Mt 13,24-30).
Und dann dürfen wir alles der unendlich großen Liebe und Gerechtigkeit Gottes überlassen. In der Gott seine Liebe, die er mit jeder Geburt (nicht erst mit der Taufe, das wäre die Arche) verbindet, niemals zurückzieht und zugleich die Menschen in dieser Liebe zum brennenden Schmerz darüber bringt, was sie an Lieblosigkeit und Grausamkeit anderen angetan haben. Aber dies geschieht im Gerettetsein, und nicht außerhalb davon.[2]
- Der Bogen am Himmel
Nicht selten wird in Bildern, Gemälden bis hinein in den Kinderbüchern die Vorstellung der Arche mit dem Regenbogen verbunden. So heißt es tatsächlich in der Bibel: „Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.“ Zunächst vom damaligen interreligiösen Hintergrund her ist damit der Kriegsbogen Gottes gemeint, mit dem der oberste göttliche Kriegsherr selbst die Menschen mit seinen Vernichtungspfeilen bedroht. Ab sofort wird Gott aber diese blitzenden Pfeile seiner Gewalt nicht mehr benutzen. Gott hat ihn weggehängt in den unerreichbaren Himmel. Es könnte auch bedeuten, dass dieser Bogen Gottes die Fluten, die von oben her kommen und nach unten zerstören, für die Zukunft aufhält.
Schon bald hat sich diese ursprüngliche Bogenvorstellung verbunden mit dem Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes mit der ganzen Menschheit. Und Bund bedeutet: dass Gott diese Menschheit und jeden Menschen ins Leben gerufen hat, nicht aus Test- und Strafgründen, sondern aus reiner Liebe und in der Vielfalt, der unendlichen Vielfalt, seiner möglichen Farben.
- Kein Straf-Gehorsamsverhältnis
Leider hat Gott dieses Versprechen, wie wir wissen, nicht gehalten. Bis heute gibt es schlimmste Naturkatastrophen und schlimmste Katastrophen, die sich Menschen selber zufügen. Aber die Botschaft des zweiten Gottesbildes bleibt: Gott jedenfalls will nicht mehr die Zerstörung von Menschen und auch nicht der Menschheit, auch nicht der Natur und der Erde, sondern wird sie retten und rettet sie stellenweise durch uns Menschen selbst.
Das erste Gottesbild des strafenden Gottes gilt nicht mehr, es gilt nur noch jene Gottesvorstellung, in der Gott, wie der Johannesbrief sagt, jeden Menschen zuerst mit seiner Geburt geliebt hat und diese Liebe niemals, in Ewigkeit nicht, zurückzieht. Es ist eine Liebe, die Freiheit atmet und nicht mit Wenn-dann Bedingungen knebelt.
- Das Glas verändert alles
Dass die Arche aus Glas ist, ist das Außergewöhnliche an diesem Kunstwerk. In der gläsernen Arche wird im Symbol des Glases, in seiner Durchsichtigkeit und auch Zerbrechlichkeit, die Verbindung zwischen innen und außen augenscheinlich. Beide gehören zusammen: die Auserwählten und die, die nicht als solche gelten. Durch das Glas hindurch sehen sie sich gegenseitig, nehmen sich wahr, und setzen sich ein für die gemeinsame Rettung. So ist diese Archeinstallation nicht nur, und das ist schon viel, ein Aufruf für unser Engagement für das Überleben der Arten, für die Rettung der Erde, für die Solidarität unter den Menschen, vor allem für die von Vernichtung Bedrohten, sondern auch ein fantastisches Symbol für die Durchsichtigkeit der verschiedenen Welten, für ihre Zusammengehörigkeit und dafür, dass Gott selbst diesen Durchblick der universalen Liebe uns schenkt und selber hat. Die nach außen abgeschlossene Schachtel wird transformiert in ein transparentes Schiff, in dem die Not der Welt, der Ertrinkenden im Mittelmeer, gesehen und wahrgenommen wird. Dieser Symbolwert des Glases fasziniert mich besonders, diese generative Symbolkraft des Materials.
Diese Arche-Installation korrigiert also, sehr bibelkritisch, das erste Gottesbild, indem sie im Material Glas die Wand zum Fenster werden lässt. Das Glas greift die alte Archevorstellung an, verfremdet sie sehr bedeutsam: Indem das Glas bereits sichtbar werden lässt, wie die biblische Geschichte ausgeht: nämlich, indem die Geschöpfe in der Arche auch die anderen zugrunde gehenden Lebewesen wahrnehmen, dass Gott auch die anderen sieht und nicht aus dem Blick verliert, sie retten wird, dass er sich um alle Menschen kümmert, nicht nur um die in der Arche.
Dafür, für die ganze Menschheit steht ja der Bogen der Rettung und des Schutzes, den Gott in den Himmel setzt. Das Symbol der Arche als Rettung von Auserwählten und der Vernichtung aller anderen, wird damit in diesem Glassymbol durchbrochen, durch ihre Gemeinsamkeit, durch ihre gegenseitige Sichtbarkeit im Horizont einer unendlichen Liebe Gottes, die in Ewigkeit gilt.
- Ein neuer Umgang mit der Bibel
So dürfen wir auch in der Bibel niemals die Stellen zum Maßstab nehmen, die Gott selbst als den großen Macher von Fundamentalismus und Vernichtung der anderen hinstellt, sondern nur jene Transformationen, in denen Gott in seiner universalen Liebe zum Vorschein kommt. Die Bibel selber ist voll von diesen Gegensätzen und das Elend der Christentumsgeschichte lag darin, dass sie sich immer wieder auf die schlimmen biblischen Stellen berufen haben und die anderen, die je gnädigeren und barmherzigen, um ihres eigenen Egoismus willen, um ihrer eigenen Herrschaft willen verkleinert und verheimlicht haben.
Es gibt immer wieder diesen Übergang vom strafenden zum universal rettenden Gott, auch im Neuen Testament: So gibt es Lk 16,19-31 die Lazarusgeschichte, wo der Reiche gnadenlos nicht in Abrahams Schoß aufgenommen wird, und so gibt es dagegen jene Unterhaltung Jesu mit dem reichen Jüngling, die in der Frage mündet, ob denn die Reichen gerettet werden und wo Jesus antwortet: „Für Gott ist alles möglich!“ (Mk 10,27), ohne die Schwierigkeit des Reichseins für die Nachfolge Jesu zu schmälern. Wehe Gott und wehe uns, wir bleiben bei den jeweils erstgenannten Bibelstellen stehen, in denen die Menschen ihre eigene Missgunst den anderen gegenüber in Gott hineinprojizieren.
- Schluss
Das Kunstsymbol der gläsernen Arche trennt nicht mehr diejenigen, die in der Arche sind, und diejenigen, die außerhalb in irgendeiner Form am Ertrinken sind, sondern verbindet sie durch Blickkontakt und daraus resultierender Verantwortung. Es atmet zwischen Innen und Außen wie es atmende Gläser gibt, mit sensiblen Geschmacksunterschieden, die die unterschiedliche Glasform ermöglicht. Die geschlossene Wand der Arche wird zum Fenster in die Welten der Nicht-dazugehörigen.
Und lässt von daher auch Gott ganz anders auf beide Seiten blicken. Gott rettet nicht nur die in der Arche sind, sondern er rettet auch alle außerhalb der Arche und lässt sie nicht zugrunde gehen. Aktuell, aus gegebenen Anlass:[3] Gott ist nicht nur auf der Seite Israels, sondern auch Palästinas! [4]
[1] Nelly Sachs, Fahrt ins Staublose, Frankfurt a. M. 1961, 82.
[2] Vgl. Ottmar Fuchs, Versöhnung durch das Geschenk unerschöpflicher Liebe und Freiheit, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 173 (2025) 1, 23-33.
[3] Als Israels Militär während des Ramadans 2025 den Waffenstillstand bricht und über 400 palästinensische Menschen, darunter über 100 Kinder ermordet.
[4] Vgl. Charlotte Wiedemann, Den Schmerz der Anderen begreifen. Holocaust und Weltgedächtnis, Berlin 2022.